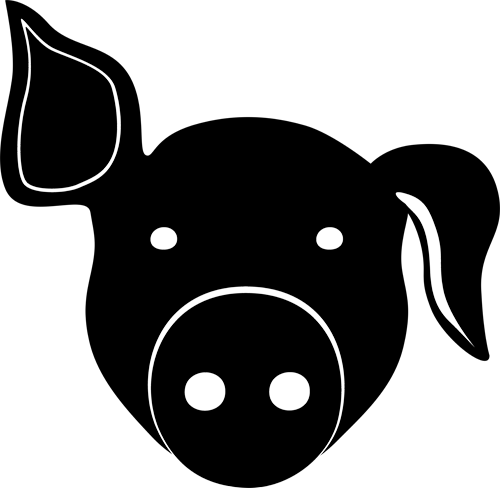Das Kollektiv
Matthias Mollner und Judith Schoßböck († 2024) waren von 2019–2024 in einer Liebespartnerschaft verbunden und planten ab 2020 gemeinsame Projekte, welche durch die Krankheiten von Judith einen besonderen Schwerpunkt bekamen.
Nach dem Tod von Schoßböck führt Mollner das Black Ferk Studio weiter.

Matthias Mollner
Gründer, künstlerische Studioleitung, Kunstproduktion
Matthias Mollner, geboren 1984 in Gmünd (Niederösterreich), lebt und arbeitet in Wien und Niederösterreich. Von 2000–2004 absolvierte er eine gestalterische Ausbildung an der Schule für Metalldesign in Steyr (Oberösterreich) und arbeitet seit 2005 als freischaffender bildender Künstler. Sein multimediales Werk umfasst Skulpturen, Installationen, Performances, Fotografien, Bilder und Videos.
Mollner beschäftigte sich bereits früh mit Performance und Körper und untersucht in seinem Werk die ambivalente Beziehung des Menschen zu Umwelt und „Natur“ und die Schattenseiten menschlicher Existenz.
Mit dem „Black Ferk Studio“ (gegründet 2021 gemeinsam mit Judith Schoßböck († 2024) ) erforscht er die Themen chronische Krankheit, Behinderung und Tod, und im Besonderen die körperliche und gesellschaftspolitische Dimension schwerer multisystemischer und/oder komplexer Erkrankungen wie ME/CFS.
Mollner realisierte zahlreiche Projekte, Ausstellungen und performative und skulpturale Interventionen in privaten und öffentlichen Räumen. Seine Werke befinden sich unter anderem in der Kunstsammlung des Landes Niederösterreich und der Neuen Galerie Graz/Museum Joanneum sowie als Dauerleihgaben am Freigelände des Symposion Lindabrunn. Mollner arbeitet als Kurator im Rahmen verschiedener Gruppen- und Einzelausstellungen.

Judith Schoßböck, PhD († 2024)
Gründerin, Studioleitung, wissenschaftliche Begleitung, Kunstproduktion
Judith Schoßböck, geboren 1981 in Braunau/Inn (Oberösterreich), gestorben 2024 in Mattighofen (Oberösterreich), lebte in Wien, London, Budapest, Hong Kong und Amsterdam.
Schoßböck studierte Medien- und Kommunikationswissenschaft, sowie deutsche Philologie und Deutsch als Fremdsprache an der Universität Wien. Sie schrieb ihre Dissertation über Gesundheitsaktivismus und soziale Medien and der City University of Hong Kong (gefördert durch das Research Grants Council, Hong Kong, S.A.R.).
Ab 2009 arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Donau-Universität Krems. Weitere Tätigkeiten waren die wissenschaftliche Co-Direktion von paraflows.at und die Organisation und Mitbegründung im Rahmen von burners.at (Kunst- und Kulturverein). Schoßböck publizierte in den Bereichen Medientechnik und Kulturwissenschaften. Sie war Managing Editor des Open-Access-E-Journal jeDEM.org. Ihre Forschungsschwerpunkte umfassten digitalen Aktivismus, elektronische Partizipation, Online Communities, soziale Medien, Gesundheitskommunikation und Ethik von Technik und Kommunikationssystemen.
Nach der unerwarteten und extremen gesundheitlichen Verschlechterung nach einer Covid-Immunisierung und anschließender Lumbalpunktion wurde Schoßböck 2021 bettlägerig und ein Pflegefall. Sie lebte bis zu ihrem Tod im Dezember 2024 mit sehr schwerem ME/CFS und weiteren Krankheiten wie Liquorverlustsyndrom, schwerem Mastzellaktivierungssyndrom (MCAS), Pankreasinsuffizienz, hormoneller Störung, usw.
Von ihrem Bett aus begann sie zu zeichnen, um mit der Welt zu kommunizieren, als andere Möglichkeiten wie Sprechen begrenzt waren. Gemeinsam mit ihrem Partner Matthias Mollner realisierte sie „CRASH!“, die erste Ausstellung zu ME/CFS in Österreich, sowie weitere Projekte, die sich darauf konzentrieren, mit den Mitteln der Kunst Bewusstsein und Sichtbarkeit für chronische Krankheiten und andere gesellschaftliche Tabuthemen zu schaffen.
Später und im Verlauf ihrer Erkrankungen wurden durch die kontinuierliche Verschlechterung die Möglichkeiten des Sprechens und Zeichens weiter stark eingeschränkt, so dass auch das künstlerische Schaffen einem ständigen erzwungenem Minimalismus unterworfen war.