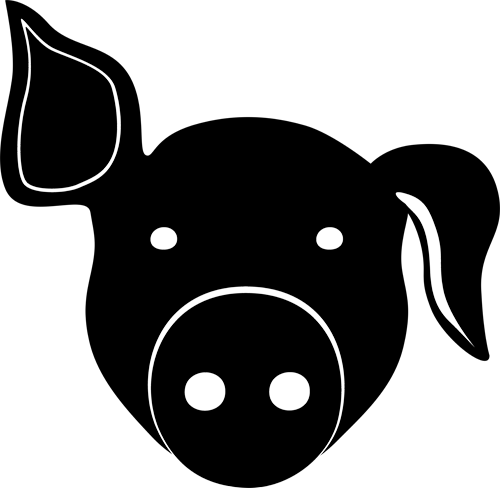Keine Frida Kahlo-Situation:
Gedanken zur Kunst als Krankheits-Bewältigung und deren Grenzen
Hallo, mein Name ist Judith und ich zeichne seit 2021 aus dem Bett heraus. Einen Rollstuhl verwenden oder aufrecht sitzen kann ich in meinen kurzen kreativen Zeiten nicht. Was aus einer Notwendigkeit statt normaler Kommunikation begonnen hat (Sprechen oder Therapie sind nicht möglich), hat sich im Laufe der Zeit zu einer Passion entwickelt, und Menschen verwendeten Komplimente wie „moderne Frida Kahlo“ und „Tarot-Set-geeignet“, wenn sie meine Arbeiten beschrieben. Es bedeutet mir auch unheimlich viel, wenn Menschen sich in meinen Werken wiederfinden oder sie einfach nur interessant finden.
Die Kunst und Kreativität, sei sie noch so klein, hat mir also auf der einen Seite unbestreitbar geholfen: und sei es nur als Eskapismus, oder, mit viel Hilfe, Teilhabe an einem Leben abseits der Kranken-Community: sie ist ja etwas, das mehrere Welten verbindet, und versucht, aus schlimmen Bedingungen etwas Schönes zu schaffen.
Und trotzdem ist das hier keine Frida Kahlo-Situation, Kunst keine Schmerz-Bekämpfung, und deren „Macht“ abseits der Romantisierung von künstlerisch tätigen Kranken — gerade für bestimmte Krankheiten — begrenzt. Das ist mir wichtig zu sagen, irgendwie zu vermitteln, begreifbar zu machen.
ME/CFS, insbesondere in einer schweren, progressiven Form, ist eine Krankheit, bei der die Uhren anders ticken. Was für andere ein „flow“, eine beruhigende Tätigkeit sein kann, ist für schwer ME/CFS-Betroffene ein Marathon, der in Folge mit einer Zustandsverschlechterung quittiert wird. Selbst der Akt des Schaffens selbst kann mehr Schmerzen bereiten als sie verhindern. Lassen wir das mal auf uns wirken, denn das ist typisch ME/CFS, das ist die verkehrte Welt, das geht gegen alles, was wir eigentlich gerne Aufbauendes hören möchten.
Die Bilder, die hier gezeigt werden, habe ich noch in einem Zustand geschaffen, in dem der unbarmherzige Kredithai meiner Krankheit noch ein bisschen sanfter war. In dem ich nicht tagelang warten musste, um eine Skizze anfertigen zu können. In dem der Akt des Zeichnens mich noch mehr vergessen hat lassen, die Passion meist stärker war als die Krankheit. Mit deren Fortschreiten wird auch diese Begeisterung zum Problem. Denn ME/CFS unterscheidet auf der schweren Stufe nicht zwischen positiver und negativer Anregung: alles hat seinen Preis.
Und so verändern sich meine Schaffensbedingungen monatlich: was vorher beruhigt hat, ist jetzt ein Marathon auf der höchsten Stress-Stufe. Und das ist ein riesen Unterschied, genauso wie es einer ist, einen Blick auf den Bildschirm eines Mobiltelefons zu ertragen oder nicht.
Diese Krankheit, so sagte eine Freundin mal, ernährt sich von Ambitionen wie Diabetes von Zucker. Und das gilt auch für die Ambition in Bezug auf die Kunst.
Aber wie soll ein kreativer Mensch aufhören, zumindest in Ideen zu denken? Wo bleibt die Hoffnung in all dem, die Rettung durch die schöne Kunst?
Zum einen bin ich stolz auf alles, was bereits war, was noch ist, und was kommt. Jedes einzelne Bild. Zum anderen denke ich, dass es eine Hoffnung gibt, die über das eigene Leben hinausgeht: und die Kunst wird auch dieses überleben.
Kreativität ist für mich ein sehr breiter Begriff geworden: an manchen Tagen bin ich froh, einen Sticker auf buntes Papier kleben zu können und nicht 100% von der Folter eingenommen zu sein. Diese „Kunst“ wird schwerlich als solche wahrgenommen werden, und trotzdem steht sie für mich gleichbedeutend, wenn nicht über vielen anderen Werken: ausschlaggebend ist immer das Gefühl, das man dabei hat: in diesem Moment kurz inspiriert und kreativ zu sein.

Judith, 2022, beim Zeichnen in ihrem Bett-Atelier.
Foto: Matthias Mollner
Judith Schoßböck, PhD, lebt mit sehr schwerem ME/CFS, Liquorverlustsyndrom, Pankreaskrankheit, hormonellen Störungen, sehr schwerem MCAS etc. bei ihren Eltern in Oberösterreich. In ihren Arbeiten werden Aspekte und Gefühle von Krankheit oft auf absurde oder witzige, aber ästhetische Weise thematisiert und so Raum für Identifikationspunkte für nichtbehinderte und behinderte Menschen geschaffen.